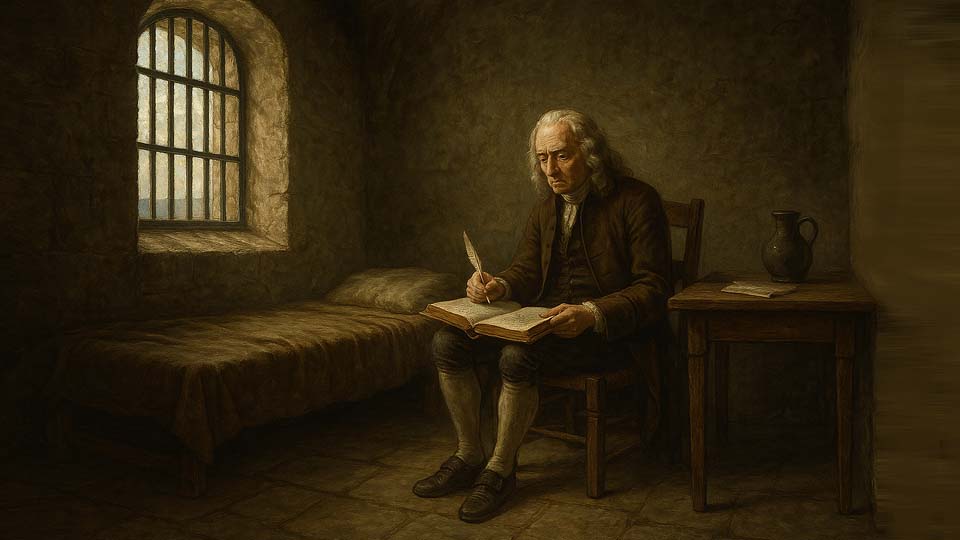"Zweifel ist unangenehm, doch Gewissheit ist absurd."
Auch wenn François-Marie Arouet alias Voltaire kein einheitliches philosophisches Gedankengebäude schuf, wie etwa Immanuel Kant oder René Descartes, bilden der Geist der Aufklärung und Humanismus den zentralen Kern seines Schaffens. Seine Religionskritik und Ablehnung des Aberglaubens gehen Hand in Hand mit oft bissiger Machtkritik und der Forderung nach mehr Skepsis und Rationalismus.
Seine Haltung in diesen Fragen war nicht nur unbequem, sie kann auch als Wegbereiter der Französischen Revolution und moderner Demokratietheorien verstanden werden. Sein Aufstieg in höchste Kreise und sein - trotz zahlreicher Krankheiten - langes und abwechslungsreiches Leben sind nicht weniger faszinierend als seine Gedanken und sein umfangreiches Werk. Das einzige Blatt, dass ihm jemals vor den Mund kam, war das, worauf er mit spitzer Feder seine Gedanken festhielt.
Das Leben Voltaires
François-Marie Arouet wird am 21.November 1694 in Paris geboren, sein Vater ist Textilkaufmann, Notar und später Richter. Seine Mutter stammt aus einer adeligen Juristenfamilie und stirbt als Voltaire sechs Jahre alt ist. Mit zehn Jahren wird er Schüler am Jesuitenkolleg Louis-le-Grand, erhält eine klassisch-humanistische Ausbildung und zeigt früh Talent beim Verfassen von Versen. Voltaire später:
"Ich verdanke ihnen meine Bildung – und meine Abneigung gegen Dogmen."
Dem Vater zuliebe schreibt er sich anschließend an der juristischen Hochschule in Paris ein, verbringt seine Zeit aber lieber mit dem Verfassen von Texten und abends in feingeistigen Salons, mitunter auch am Spieltisch. Der enttäuschte Vater sanktioniert seinen Sohn, indem er ihn auf Geschäftsreise nach Den Haag schickt. Voltaires Liebschaft mit einer jungen Dame ebendort veranlasst wiederum deren Mutter sich bei Voltaires Dienstherrn über ihn zu beschweren und so wird er wieder zurück nach Paris geschickt.
„Zwei Dinge bedeuten mir Leben: die Freiheit und das Objekt meiner Liebe.“
Obwohl sein Vater ihm erst mit Enterbung und Deportation nach Amerika droht, akzeptiert er schließlich das Leben seines Sohnes als Literat, inklusiver dessen regelmäßiger Teilnahme an nächtlichen Gesellschaften. Dort ist er stets gefragt, macht sich aber auch bald namhafte Feinde, wie die Mitglieder der Académie française. Man schätzt seinen scharfen Verstand und seine literarischen Spitzen und schnell verkehrt er im royalen Umfeld, wie etwa am kleinen Hof des Duc du Maine, einem außerehelichen Sohn von Ludwig XIV.
Bastille I
Ein satirisches Gedicht mit der Anspielung auf ein inzestuöses Verhältnis des Cousins des Duc du Maine, Philipp von Orléans, mit dessen Tochter bringt ihm seine erste mehrmonatige Verbannung ein. Nach der Rückkehr nach Paris schlägt er mit einem neuen Gedicht in dieselbe Kerbe, leider ist beim Vortrag ein Polizeispitzel anwesend. Resultat: erste Inhaftierung in der Bastille im Jahre 1717. Nur durch den Einsatz namhafter Fürsprecher kommt er nach 11 Monaten wieder frei, wird aber daraufhin wieder verbannt. Die nächsten eineinhalb Jahre verbringt er zumeist schreibend auf dem Landsitz des jungen Herzogs von Sully und in verschiedenen Schlössern rund um Paris.
"Die Mauern der Bastille sind dick, aber sie halten den Geist nicht auf."
Von nun an (ab 1719) unterzeichnet er mit seinem Pseudonym Voltaire. In einem Brief an Rousseau nennt er als Grund die Verwechslungsgefahr mit dem Libretisten Pierre-Charles Roy, da "Arouet" wie "A-Roy" ausgesprochen wurde. Pierre-Charles Roy (1683-1764) ist Favorit der gehobenen Gesellschaft - bis zum Auftauchen Voltaires. Beide bleiben sich von da an in inniger Feindschaft lebenslang verbunden. Über die Bedeutung des Namens "Voltaire" gibt es mehrere Theorien. Die Umkehrung des Namens seiner Heimatregion Airvault zu Vaultair ist aber ebenso naheliegend wie die Kombination daraus mit der Verkürzung von "volontaire" ("freiwillig", aber auch "eigenwillig" oder "eigensinnig").
Nach dem Tod seines Vaters 1722, erbt er eine stattliche Summe und erhält vom selben Jahr an eine jährliche Pension aus der königlichen Schatulle für seinen ersten großen Erfolg, das Theaterstück Ödipus. Endlich finanziell unabhängig beginnt er ein intimes Verhältnis mit der verheiraten Madame de Bernières, der Frau eines hochrangigen Justizbeamten und unternimmt seine erste größere Reise in die österreichischen Niederlande. Zurück in Paris bekommt er 1725 auch endlich Zutritt zum Hof von Ludwig XV. und eine zweite Pension für die Leitung der Theateraufführungen anlässlich der Hochzeit des Regenten.
„Es gibt kein Land auf Erden, in dem nicht die Liebe Verliebte zu Dichtern macht.“
Bastille II
Seine Antwort auf die Frage von Chevalier Guy-Auguste de Rohan-Chabot, wie er denn zu seinem neuen Namen gekommen sei, zieht in erster Instanz eine Tracht Prügel für den Dichter nach sich und anschließend eine neuerliche Verurteilung und Haft in der Bastille (1726). Stein des Anstoßes ist die Antwort: "Ich bin der Erste meines Namens, mein Herr, Ihr seid der Letzte des Euren." Vor dem Gesetz ist man als Nicht-Adeliger eben nicht gleich und es ist nur seiner Berühmtheit geschuldet, dass er aus der Bastille entlassen und die Strafe in Verbannung umgewandelt wird. Geeignetes Exil findet er in
England
Im Gegensatz zu Frankreich (und dem Rest Europas) ist England nach der "Glorious Revolution" von 1688 eine parlamentarische konfessionell geprägte Monarchie. Voltaire ist begeistert von den Freiheiten der Bürger und der freigeistigen Atmosphäre kurz vor Beginn der Industriellen Revolution. König Georg I. ist als frankophil bekannt und bald verkehrt Voltaire auch in England in den allerhöchsten Kreisen.
"Verbrennt eure Gesetze und macht deren neue. Woher die neuen nehmen? Aus der Vernunft!"
Er lernt Englisch in Wort und Schrift und liest die Arbeiten von Isaac Newton, John Locke und die Dramen von William Shakespeare. In England fühlt er sich endlich als freier Mann. Seine nach dieser Zeit benannten "Englischen Briefe" (auch "Philosophische Briefe") sind richtungsweisend für den Beginn der Aufklärung. Das absolutistische Frankreich und die damit verbundene Enge in seiner Heimat veranlassen ihn zu süffisanten, ganz und gar nicht patriotischen Vergleichen wie:
"Die Franzosen sind Kinder, die Engländer Männer." oder "England ist das Land der Philosophen, Frankreich das der Tänzer."
Jackpot
Nach seiner Rückkehr beginnt Voltaire sein kleines Vermögen gezielt zu vergrößern, ohne Adelstitel die beste Möglichkeit um unabhängig seiner gesellschafts- und machtkritischen Haltung treu zu bleiben. Hat er bereits vor seinem Aufenthalt auf den britischen Inseln klammen Zeitgenossen Geld gegen Zinsen geliehen, beteiligt er sich nun mit immer größeren Summen gewinnbringend an verschiedenen Reedereien.
Ein besonders einträglicher Coup gelingt ihm mit dem Knacken der Pariser Lotterie (1729-1730), indem er zusammen mit dem Mathematiker Charles Marie de La Condamine (1701-1774) alle Lose aufkauft und den Hauptgewinn einstreicht. Ein Rechenfehler bei der Kalkulation vom Verhältnis der Erlöse zum Gewinn, der dem zuständigen Finanzminister unterlaufen war, bescheren Voltaire und seinem Freund je 500.000 Livre. Nach heutiger Kaufkraft immerhin die stattliche Summe von mindestens 5 Mio. Euro - für jeden der beiden.
"Wenn es um Geld geht, sind alle einer Meinung."
Liebe & Wissenschaft
Seine Analysen der französischen Verhältnisse im Vergleich zu den englischen verärgern viele der Höflinge und Königstreuen. An Anfeindungen mangelt es dem Aufklärer nie. Die Veröffentlichung der "Englischen Briefe" wird ihm untersagt, weil "anstößig". Sie werden öffentlich verbrannt und ein weiterer Haftbefehl gegen ihn erlassen.
So flüchtet er 1734 auf das Anwesen seiner neuen Geliebten Émilie du Châtelet auf Schloss Cirey-sur-Blaise in der Champagne, das dem Marquis Florent Claude du Châtelet gehört - dem Ehemann seiner neuen Geliebten. Diese Liebschaft in denen er sich zusätzlich zu Poesie und historischen Studien - inspiriert durch seine Geliebte und die Schriften Isaac Newtons - auch mit Naturwissenschaft beschäftigt, dauert 15 Jahre.
Gemeinsam verfassen sie eine Abhandlung über die physikalisch bzw. chemischen Grundlagen des Feuers. Die Beziehung endet, als sich Émilie du Châtelet in einen jüngeren literaturbegeisterten Offizier verliebt. Sie bekommt ein Kind von diesem und stirbt 1749 während des Kindbetts. Obwohl Voltaire zahlreiche Freunde und Unterstützer in Paris hat, wird er sich nie mehr dort niederlassen. Seine nächste Partnerin, die ihn bis an sein Lebensende begleitet, wird seine Nichte Marie Louise Mignot.
„Die Liebe ist ein Stoff, den die Natur gewebt und die Phantasie bestickt hat.“
Enttäuschte Könige
Madame de Pompadour ist es auch zu verdanken, dass Voltaire Teil der höfischen Gesellschaft am Hof Ludwigs XV. wird. Er bleibt aber wohnhaft auf Schloss Cirey-sur-Blaise um jederzeit ins benachbarte Ausland fliehen zu können. Auch ihr ist es zu verdanken, dass Voltaire 1745 vom König zum Landeschronisten und 1746 einstimmig in die Académie française aufgenommen wird. Intrigen sind Bestandteil des höfischen Alltags, verschont wird niemand. Der Tod seiner einstigen Geliebten, Querelen mit anderen Günstlingen und ein Zerwürfnis mit dem König selbst, bringen ihn 1749 so weit, in diplomatischer Mission nach Potsdam zu reisen.
Mit Friedrich II., einem weiteren Bewunderer Voltaires, verbindet ihn bereits seit langem ein reger Briefwechsel, aber den regelmäßigen Einladungen des preußischen Regenten war er immer wieder ausgewichen. Der Monarch ist begeistert von seinem neuen Gast, eine weitere Perle in der bereits beachtlichen illustren Schar in Sans-Souci. 1750 erhält er vom König den Orden "Pour le Mérite", eigentlich eine Auszeichnung für besondere Leistungen auf dem Schlachtfeld. Es folgen ein Prozess um Geldgeschäfte mit einem Bankier, neuerliche Bücherverbrennung, die üblichen Intrigen und ein Zerwürfnis mit dem Monarchen. Die diplomatische Mission scheitert und 1753 verlässt er Berlin und Sans-Souci.
Mit "Sans-Souci" ("ohne Sorgen") ist endgültig Schluss, als Voltaire bei seiner Abreise im Hotel "Goldener Löwe" in Frankfurt, nach einer Anordnung Friedrichs, unter Hausarrest gestellt wird. Der Regent besteht auf der Rückgabe eines geliehenen Buches mit pikanten und unangenehmen Details über wichtige Verbündete und fürchtet Konsequenzen durch deren eventuelle Veröffentlichung. Außerdem soll angeblich die überschaubare Summe von 20 Dukaten ausständig sein, Voltaire sieht das anders. Er flieht und wird erneut verhaftet und verhört.
"Es ist gefährlich, recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat."
Danach folgen Aufenthalte an einigen kleineren deutschen Höfen (Mainz, Schwetzingen, Mannheim). In Paris erwarteten ihn Zensur und Verfolgung, der preußische König bekam sein Buch nie wieder (dafür die Verbreitung der ärgerlichen Details), also ab in die Schweiz, wo Voltaire 1755 den Landsitz Les Délices bei Genf erwirbt und sich dort niederlässt.
Auch in der Schweiz der übliche Ärger mit Zensur und übereifrigen Christen. Egal ob reformiert oder römisch-katholisch, diesen war er schon immer ein Dorn im Auge und bleibt es weiterhin. Voltaire glaubt zwar an Gott, hat aber weder Vertrauen in seine irdischen Repräsentanten, noch in zeremonielles Brimborium und Indoktrinierung.
"Lasst uns Gottes Pläne verehren und ihm nicht die Fehler der Menschen vorwerfen."
Untergang der Goldenen Stadt
1755 ereignet sich die Katastrophe von Lissabon, die mit Erdbeben, Tsunami und anschließendem Großbrand beinahe die ganze Stadt zerstört, Zehntausende Menschen tötet und damit das Ende einer glorreichen portugiesischen Epoche bedeutet. Voltaire stößt sich an der damals weit verbreiteten Vorstellung einer göttlichen Strafe und stellt sich gegen naturreligiöse Zeitgenossen wie Pascal, Rousseau und Pope. Leibnitz' Optimismus ("Unsere Welt ist die beste aller möglichen Welten") kann er endgültig nicht mehr nachvollziehen und entgegnet in seinem Roman "Kandide":
"Wenn dies die beste aller möglichen Welten ist – wie schlimm müssen dann die anderen sein?".
Tief betroffen, arbeitet er an einer Universalgeschichte der Menschheit, die er insgesamt auf dem Weg des Fortschritts sieht. Mit seinen kulturhistorischen Schriften, die er bereits seit über 20 Jahren verfasst, wird er zum Begründer der Geschichtsphilosophie. Seine Schriften dazu sind geprägt vom Wunsch nach Gerechtigkeit. Auch wenn Besitz immer ungleich verteilt bleiben wird, erscheint ihm die Gleichheit aller Bürger im Staat als erstrebenswertes Ziel.
"Es ist nicht das natürliche Schicksal des Menschen, angekettet zu sein und erwürgt zu werden."
Gartenidylle
1758 und 1759 erwirbt er in der Nähe von Genf, aber auf französischem Boden, die Landgüter Ferney und Tourney. Sein Leben lang bleibt er in der Nähe von Grenzen, um diese - wenn notwendig - überschreiten zu können. Das darf sowohl geografisch, gesellschaftlich und künstlerisch gedeutet werden. Von nun an bestellt er seinen Garten (bzw. lässt bestellen) und kümmert sich fürsorglich um seine Angestellten. Ein Umstand, der für wohlhabende Zeitgenossen eigentlich selbstverständlich sein sollte. Seine spät verfassten Memoiren bleiben unveröffentlicht, werden (zur Abwechslung wieder einmal) öffentlich verbrannt und erscheinen erst nach seinem Tod.
"Es brauchte Jahrhunderte, um der Menschheit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, um zu merken, dass es schlecht ist, wenn der Großteil säet und die Minderheit erntet..."
"Vive Voltaire!"
Anlässlich der Uraufführung seines neuen Stücks "Irène" 1778 reist Voltaire nach fast 30 Jahren im Exil ein letztes Mal nach Paris und genießt den triumphalen Empfang, der ihm bereitet wird. Er erhält vorübergehend die Leitung der Sitzungen der Académie française, das Stück wird ein großer Erfolg und er wird feierlich in die Freimaurerloge "Les Neuf Sœurs" aufgenommen. Ludwig XV. ist inzwischen verstorben, sein Nachfolger Ludwig XVI. (bis 1793 mit Kopf) verweigert eine direkte Begegnung. Am 30.Mai 1778 stirbt Voltaire im Alter von 83 Jahren in Paris. Die letzte Ölung lehnte er mit folgenden Worten aus Überzeugung ab:
"Es erscheint mir höchst lächerlich, sich ölen zu lassen, ehe man in die andere Welt eingeht. Es ist so, wie wenn man die Achsen seines Wagens vor einer Reise schmieren lässt."
Der Klerus verweigert ihm ein christliches Begräbnis, obwohl Voltaire sich selbst immer als Christ sah. Am 11. Juli 1791 werden die Gebeine Voltaires ins Pariser Panthéon überführt. Sein Sarkophag trägt die Inschrift "Als Dichter, Historiker, Philosoph machte er den menschlichen Geist größer und lehrte ihn, dass er frei sein soll."
Im selben Jahr erwirbt seine langjährige Brieffreundin, die russische Zarin Katharina II. ("Der strahlendste Stern des Nordens"), seine Bibliothek mit rund 7.000 Büchern in Ferney und lässt Voltaires Arbeitszimmer in der Eremitage originalgetreu nachbauen. Die vollständige Bibliothek befindet sich bis heute in der Russischen Nationalbibliothek in Sankt Petersburg.
Wichtigste Werke
"Das Geheimnis zu langweilen besteht darin, alles zu sagen."
Diesen Ratschlag befolgend hier nur ein kleiner Auszug seiner wichtigsten Schriften in chronologischer Reihenfolge mit kurzem Zitat. ("Kandide oder Die beste aller Welten", "Die Geschichte Karls XII., Königs von Schweden", "Die Prinzessin von Babylon" und "Zadig oder Das Schicksal" befinden sich auf TechnoSoph|Bücher zum online lesen.)
Ödipus (1719): erste erfolgreiche Tragödie, Voltaire wird berühmt.
"Die Tugend erniedrigt sich, wenn sie sich rechtfertigt."
Die Liga/ Die Henriade (1723/1728): englisches Nationalepos und zugleich episches Gedicht über Heinrich IV. und religiöse Konflikte in Frankreich.
"Steig herab aus den Himmeln, erhabene Wahrheit! Erfülle meine Schriften mit deiner Kraft und Klarheit."
Die Geschichte Karls XII., König von Schweden (1730): historische Biografie über den schwedischen König.
"Gewiss ist nichts wahrscheinlicher als ein Verbrechen; aber es muss wenigstens nachgewiesen sein."
Philosophische Briefe (1733-1734): Vergleich England-Frankreich, Meilenstein der Aufklärung.
"Es ist gefährlich, recht zu haben in Dingen, bei denen angesehene Männer im Unrecht sind."
Der Weltmensch (1736): provokatives Gedicht über Luxus und Fortschritt.
"Das Überflüssige – eine sehr notwendige Sache."
Elemente der Philosophie Newtons (1738): Einführung in die Physik Newtons.
"Die Natur ist ein großes Buch, das allen Augen offensteht."
Mohammed und der Fanatismus (1741): Tragödie über religiösen Fanatismus.
"Der Fanatismus ist ein Monster, das sich wagt, sich als Sohn der Religion auszugeben."
Merope (1743): Erfolgreiche Tragödie.
"Der Schmerz ist der Preis der Liebe."
Zadig oder das Schicksal (1747): philosophischer Roman über Schicksal und Vernunft.
"Wir müssen unseren Garten bestellen."
Das Zeitalter Ludwigs XIV. (1751): kulturhistorisches Hauptwerk über das 17. Jahrhundert.
"Die Geschichte ist die Erzählung von Verbrechen und Unglück."
Micromegas (1752): satirische Science-Fiction über Relativität und Perspektive.
"Ich sehe mehr denn je, dass man nichts nach seiner scheinbaren Größe beurteilen sollte."
Essay über den Geist und die Sitten der Nationen (1756): Universalgeschichte mit Fokus auf Kultur und Moral.
"Die Geschichte ist eine Abfolge von Verbrechen, Torheiten und Unglück."
Kandide oder der Optimismus (1759): berühmtester Roman, beißende Kritik an Leibniz’ Optimismus.
"Wenn dies die beste aller möglichen Welten ist – wie schlimm müssen dann die anderen sein?"
Über die Toleranz (1763): Plädoyer für religiöse Toleranz.
"Denn zum Hassen und Verfolgen haben wir Religion genug, aber nicht zum Lieben und Helfen."
Philosophisches Taschenwörterbuch (1764): Sammlung kritischer Artikel zu Religion, Philosophie und Gesellschaft.
"Der Abergläubische ist für den Schurken, was der Sklave für den Tyrannen ist."
Der Harmlose (1767): Roman über einen naiven Bretonen, der die Welt entdeckt.
"Es ist seltsam, dass Menschen bestraft werden müssen, um das Denken zu lernen."
Die Prinzessin von Babylon (1768): erscheint anonym. Märchenhafte, allegorische Reise, um politische Systeme, Religionen und kulturelle Eigenheiten zu kommentieren.
"Das Beste ist der Feind des Guten."
Der weiße Stier (1773): Spätwerk, allegorische Kritik an religiösem Dogma.
"Die Menschen sind dazu gemacht zu denken, nicht blind zu glauben."
Irene (1778): letzte Tragödie.
"Das Herz einer Frau ist ein Abgrund, den die Vernunft niemals ergründet."
Abschließend das vermeintlich bekannteste Zitat von Voltaire, das aber gar nicht von ihm stammt. Evelyn Beatrice Hall (alias S.G. Tallentyre) charakterisierte in ihrem 1906 erschienen Buch "Die Freunde Voltaires" seine Haltung zur Toleranz, indem sie resümiert:
"Ich missbillige, was du sagst, aber ich würde bis auf den Tod dein Recht verteidigen, es zu sagen."